«Fälle von Fuchsbandwurm nehmen zu»

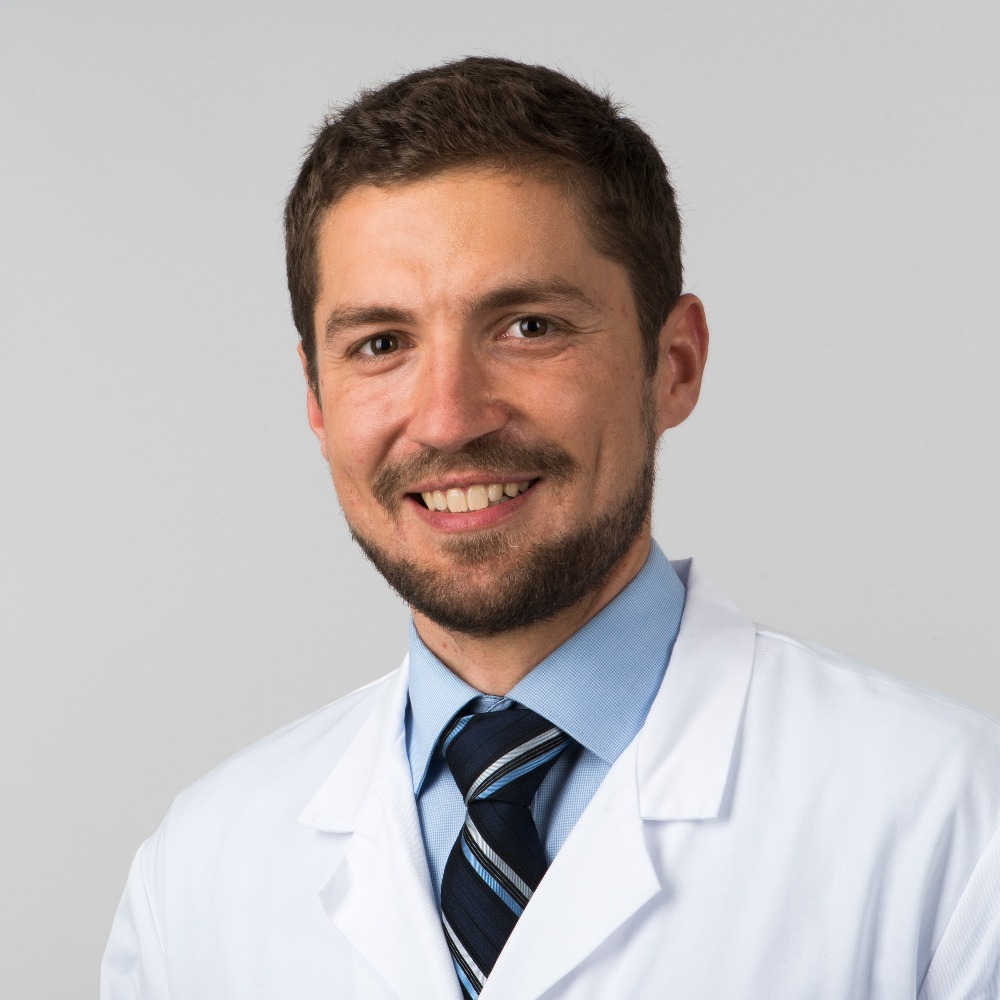
Simon Koechlin: Herr Müllhaupt, Herr Deibel, Sie waren beteiligt an einer kürzlich erschienenen Übersichtsstudie [1], welche die Entwicklung von alveolären Echinokokkose- Fällen in Europa über die letzten 25 Jahre analysierte. Was haben Sie dabei entdeckt?
Beat Müllhaupt: Wir haben die Zürcher Daten zur Untersuchung beigesteuert. Insgesamt zeigte sich, dass die Häufigkeit der Neuerkrankungen mit dem Fuchsbandwurm in fast allen Ländern zunimmt.
Also auch in der Schweiz?
Rudolf Ansgar Deibel: Ja, wir zählen ungefähr 0,5 Fälle pro Jahr und 100 000 Einwohner, also insgesamt knapp 50 Fälle landesweit. Dies entspricht ungefähr einer Verdoppelung seit der Jahrtausendwende. Allerdings bleiben diese Zahlen eine Schätzung: In der Schweiz gilt Echinokokkose nicht als meldepflichtige Erkrankung, es gibt deshalb kein nationales Register.
Was sind die Gründe für die Zunahme?
Müllhaupt: Es gibt drei Faktoren, die diskutiert werden: mehr Füchse, insbesondere auch in Städten, bessere Diagnostik und mehr Immunsuppressionen. In der Schweiz wurden Füchse, die Hauptwirte des Fuchsbandwurms, in den 1960erund 1970er-Jahren während einer Tollwutepidemie stark dezimiert. Nachdem das Tollwutproblem gelöst war, stiegen die Fuchspopulationen erneut an. Ungefähr 10 bis 15 Jahre später begann man, einen Anstieg der Echinokokkose im Menschen zu sehen – die Krankheitsbilder treten beim Fuchsbandwurm erst Jahre bis Jahrzehnte nach der Infektion auf.
Deibel: Der zweite Faktor hängt damit zusammen, dass heute viel häufiger Ultraschall-, CT- oder MRI-Bilder gemacht werden, mit denen zufällig auch asymptomatische Fälle entdeckt werden. Die dritte Theorie haben französische Forschende postuliert: Sie beobachteten einen Anstieg an Neudiagnosen in Patientinnen und Patienten mit einer immunsupprimierenden Erkrankung und/oder Medikamenten; diese Personen könnten empfänglicher für eine Infektion mit alveolärer Echinokokkose sein. Einen solchen Zusammenhang sehen wir bei uns am Universitätsspital Zürich allerdings nicht. Der Hauptanteil an Neudiagnosen betrifft Menschen, die nicht immungeschwächt sind.
Der Mensch ist ein Fehlwirt, der Bandwurmeier aufnimmt, die der Fuchs als Hauptwirt ausgeschieden hat. Damit der Bandwurm seinen Zyklus vollenden kann, braucht es aber auch Zwischenwirte: Nagetiere wie Mäuse. Können neben den Fuchsbeständen auch die Mäusevorkommen die Infektionshäufigkeit beeinflussen?
Deibel: Im Groben ja. Die Ausbreitung des Fuchsbandwurms ist abhängig davon, ob der richtige Zwischenwirt vorhanden ist. Professor Peter Deplazes, ehemaliger Leiter des Instituts für Parasitologie der Universität Zürich, hat in einem Feldversuch gezeigt, dass im Tessin der Fuchsbandwurm nur in den nördlichsten Tälern vorzufinden ist, wo auch der wichtigste Zwischenwirt, die Feldmaus, vorkommt. Ob eine Veränderung des Mäusebestandes die Infektionshäufigkeit verändert, wissen wir nicht, da es dazu keine Untersuchungen gibt. Deplazes hatte durch die Untersuchung von Fuchskotproben in Zürcher Naherholungsgebieten herausgefunden, dass ungefähr ein Viertel bis die Hälfte aller Füchse Bandwurmeier ausscheiden. Und ungefähr 10 bis 20 Prozent der gefangenen Mäuse waren infiziert. Aber das war eine Momentaufnahme.
Müllhaupt: Früher sagte man oft, dass vor allem die Landbevölkerung vom Fuchsbandwurm betroffen sei. Das stimmt heute sicher nicht mehr. Füchse finden sich in Siedlungsräumen sehr gut zurecht und haben dort oft sogar mehr Nahrung auf einer bestimmten Fläche.
Neben dem Fuchs ist auch der Hund ein möglicher Endwirt für den Fuchsbandwurm. Welche Rolle spielen infizierte Hunde bei der Ansteckung?
Müllhaupt: Bei Hunden, die mausen, kann der Erreger in 3 bis 7 Prozent der Tiere nachgewiesen werden. Bei einem Forschungsprojekt in Kirgistan haben wir gesehen, dass Hunde dort wohl ein wesentliches Reservoir darstellen. Denn sie werden nicht gefüttert und müssen sich ihre Nahrung selbst suchen. In der Schweiz werden die meisten Hunde regelmässig entwurmt und fangen selten Mäuse. Entsprechend gibt es hier weniger infizierte Hunde.
Welches sind die häufigsten Infektionsquellen für den Menschen bei uns?
Müllhaupt: Das wissen wir nicht so genau. Wenn wir Patientinnen und Patienten im Spital sehen, sind schon Jahre oder Jahrzehnte seit der Infektion vergangen. Risikogruppen sind Jäger, Hundehalter und Beerensammler. Aber wie die Infektionswege ablaufen, ist kaum bekannt. Es gibt viele Möglichkeiten. Es passiert zum Beispiel rasch, dass man Fuchskot an den Schuhen in die Wohnung bringt und später oral aufnimmt.
Wie verläuft die Infektion beim Menschen?
Deibel: Die Larvalstadien des Fuchsbandwurms gelangen vom Magen-Darm- Trakt über die Blutgefässe in die Leber. Dort nisten sie sich ein und bilden ein Larvengewebe. Dieses Gewebe wächst sehr langsam und wie ein aggressiver Tumor. Je nach Ausprägung verursacht es mehr oder weniger Probleme. Es kann zum Beispiel zentrale Gefässe oder Gallenwege der Leber verengen. Die Larven können zudem auch in die Lunge, in die Milz oder ins Hirn gelangen.
Was sind typische Symptome, die Hausärztinnen und Hausärzte beachten sollten?
Deibel: Das häufigste Symptom sind Oberbauchschmerzen. Diese treten jedoch bei vielen Erkrankungen auf – doch in einem solchen Fall sollte eine Ultraschalluntersuchung der Leber erfolgen. Ein deutlicheres Indiz für eine mögliche alveoläre Echinokokkose ist ein Verschlussikterus. Ein solcher kann entstehen, wenn die Gallenwege durch das Larvengewebe verschlossen werden. Dann ist eine weitere Abklärung mittels Bildgebung zwingend notwendig.
Wie verläuft die Diagnostik?
Deibel: Bei einem Verdacht stehen bildgebende Verfahren wie Ultraschall, CT oder MRI für die Diagnose zur Verfügung. Hinzu kommt eine spezifische Serologie. Die Echinokokkose stellt sich in der Bildgebung sehr variabel dar. Auch wenn die Veränderungen für Spezialisten gut erkennbar sind, kommt es aufgrund der Seltenheit der Erkrankung und wegen Verwechslungsmöglichkeiten relativ oft zu Fehldiagnosen.
Worauf müssen Ärztinnen und Ärzte bei der Differenzialdiagnose achten?
Deibel: Es gibt einige Tumorarten, zum Beispiel der Gallengangkrebs oder Leberhämangiome, mit denen die alveoläre Echinokkokose verwechselt werden kann. Und die zystische Echinokokkose, also die Infektion mit dem Hundebandwurm.
Müllhaupt: Allerdings kommt der Hundebandwurm in der Schweiz nicht vor. Das ist eine wichtige Nachricht für Ärztinnen und Ärzte: Bei Schweizer Patientinnen und Patienten tritt eigentlich nie eine zystische Echinokokkose auf – man bringt die Erkrankung auch nicht einfach von einem Ferienaufenthalt nach Hause. Wir hatten nur einen oder zwei Schweizer Fälle in über 30 Jahren – einer war eine Frau, die sehr viel Zeit in Tibet verbracht hatte.
Worauf beruht die Therapie des Fuchsbandwurms?
Müllhaupt: Wir haben kürzlich unsere Therapieerfahrungen in Zürich über die letzten 50 Jahre in einer Studie zusammengefasst [2]. Früher war die Chirurgie entscheidend. Wenn man die Zysten operativ aus der Leber entfernen konnte, war die Prognose gut. Hingegen starben rund 90 Prozent jener Patientinnen und Patienten, bei denen sich Larvalstadien nicht entfernen liessen, innert zehn Jahren. Allerdings wurde damals die Erkrankung bei sehr vielen Patientinnen und Patienten erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt.
Wie verläuft die Therapie heute?
Deibel: Ungefähr Mitte der 1970er-Jahre wurden Benzimidazol-Präparate eingeführt, zuerst Mebendazol und einige Jahre später Albendazol. Dank dieser Wirkstoffe stieg die Lebenserwartung von Patientinnen und Patienten, die nicht operiert werden konnten, deutlich. Um die Jahrtausendwende kam man deshalb davon ab, palliativ zu operieren – also um die Masse des Bandwurmbefalls zu reduzieren. Heute, noch einmal zwanzig Jahre später, behandeln wir zunehmend sogar Patientinnen und Patienten medikamentös, bei denen man eigentlich sämtliche Läsionen operativ entfernen könnte.
Weil die Medikamente derart gut sind?
Müllhaupt: Ja, wir sehen bei der Überlebenswahrscheinlichkeit kaum noch Unterschiede. Wir können deshalb die Therapie individualisieren: Wenn operiert wird, dann nur noch, wenn man wirklich alles herausschneiden kann. Bei einem älteren Menschen, bei dem eine Operation gefährlich wäre, können wir aber auch auf eine medikamentöse Therapie setzen. Ebenso bei jüngeren Betroffenen, die skeptisch sind, sich wegen wenigen kleiner Läsionen einen oft grossen Teil der Leber entfernen zu lassen.
Dafür müssen solche Patientinnen und Patienten ihr Leben lang Medikamente einnehmen.
Müllhaupt: Nicht mehr in jedem Fall. Zwar töten Albendazol und Mebendazol die Parasiten nicht ab, sondern verhindern bloss sein Wachstum. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass man in ungefähr 20 bis 30 Prozent der Fälle die Therapie nach einigen Jahren stoppen kann, ohne dass die Zysten wieder wachsen.
Welche Kriterien müssen für das Absetzen der Therapie erfüllt sein?
Deibel: Wir messen Antikörper gegen das Antigen Em-18 und kontrollieren mittels einer PET-CT-Diagnostik, ob das Immunsystem um die Parasitenläsionen aktiv ist. Wenn der Em-18-Antikörper negativ ist und das PET-CT keine Entzündungen um den Parasiten zeigt, sind wir relativ sicher, dass wir die Therapie stoppen können. Wir haben bis heute bei rund dreissig Patienten die Medikamente abgesetzt, nur bei zwei kam es zu einer Reaktivierung des Infektionsgeschehens.
Insgesamt haben sich also die Behandlungsmöglichkeiten für die alveoläre Echinokokkose in den letzten Jahrzehnten markant verbessert?
Müllhaupt: Genau. Die Fortschritte sind enorm. Wir sehen zwar heute noch eine leicht verringerte Lebenserwartung von Echinokokkose-Patienten gegenüber der Normalbevölkerung. Aber es scheint nicht am Bandwurm zu liegen. Ein Grund könnte sein, dass die Zufallsdiagnosen bei Menschen gemacht werden, die bereits einen schlechteren Gesundheitszustand aufweisen.
In welchen Bereichen besteht Forschungsbedarf?
Müllhaupt: Einerseits gibt es bei Diagnostik noch immer Verbesserungspotenzial. Andererseits sind wir mit nur zwei Präparaten aus derselben Medikamentengruppe bei der Therapie stark eingeschränkt. Die Wirkstoffe haben zwar wenige Nebenwirkungen, aber wenn die Betroffenen sie nicht gut vertragen, gibt es kaum Alternativen. Eine Therapie, welche die Parasiten rasch abtötet, wäre bahnbrechend.
Weshalb ist es bisher nicht gelungen, einen Wirkstoff zu entwickeln, der rasch alle Parasiten abtötet?
Deibel: Zum einen ist dies ein komplexes Unterfangen. Zum anderen fehlt der finanzielle Anreiz: In der europäischen Übersichtsstudie haben wir gerade einmal 4200 Fälle über 25 Jahre zusammengetragen. Dafür ein neues Medikament zu entwickeln und zuzulassen, lohnt sich für eine Pharmafirma schlicht nicht. Darum ist der wahrscheinlichere Weg, ein Medikament zu finden, das schon für eine andere Anwendung zugelassen ist. Eine Gruppe an der Universität Bern erforscht solche bestehenden Substanzen, zum Beispiel Malariamittel. Bislang jedoch ohne durchschlagenden Erfolg.
Gibt es andere Herausforderungen?
Müllhaupt: Ein grosses Problem sind Lieferschwierigkeiten für die Medikamente. Das ist ein Thema, das man vor zwanzig Jahren nicht kannte. Heute gibt es immer wieder Phasen, in denen die Medikamente in der Schweiz nicht erhältlich sind. Das beschert uns viel Zusatzaufwand und bedeutet einen riesen Stress für die Patientinnen und Patienten.
Noch ein Blick in die Zukunft: Denken Sie, dass die alveoläre Echinokokkose in den nächsten Jahrzehnten noch häufiger wird?
Müllhaupt: Das ist eine gute Frage. Unsere Studie sieht eine Zunahme. Aber es hängt stark von der Entwicklung der Fuchsbestände ab. Aktuell gibt es mehr Fälle von Fuchsräude. Das könnte die Populationen dezimieren und den Infektionsdruck lindern.
Braucht es auch Verhaltensänderungen in der Bevölkerung?
Müllhaupt: Ich halte nicht viel davon, Panik zu schüren. Die alveoläre Echinokokkose ist noch immer eine sehr seltene Erkrankung. Eine gute Empfehlung ist, sich regelmässig die Hände zu waschen. Und Gemüse zu waschen – auch dasjenige aus dem eigenen Garten. Denn auch daran kann der Kot eines Fuchses kleben.
Literatur
- Casulli A et al. Unveiling the incidences and trends of alveolar echinococcosis in Europe: a systematic review from the KNOW-PATH project. Lancet Infect Dis. 2025; S1473- 3099(25)00283-X
- Deibel A et al. Comprehensive Survival Analysis of Alveolar Echinococcosis Patients, University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland, 1973–2022. Emerg Infect Dis. 2025; 31(5): 906-916
